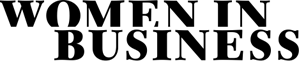Andrea Rytz, Chefin von 1250 Mitarbeitenden der Schulthess Klinik in Zürich, über Zielstrebigkeit, Tyrannen im Arztkittel und Herausforderungen, nun, da sie angekommen ist, am Ziel ihrer Träume.
WOMEN IN BUSINESS: Frau Rytz, Sie haben es von der Röntgenfachfrau zur Spitaldirektorin gebracht. Überrascht?
Andrea Rytz: Nein. Das war seit Abschluss meiner Lehre mein erklärtes Ziel.
Im Ernst?
Im Ernst. Als ich mit 21 vom Inselspital ans Unispital in Zürich wechselte, fragte mich Herr Fiechter, der damalige Chef-Röntgenassistent, was machen Sie in fünf Jahren? Ich antwortete, das weiss ich nicht genau, denke, ich arbeite dann immer noch im Röntgen, bin eine gute Fachfrau, bilde Junge aus. Und dann sagte ich: Was ich weiss, ist, dass ich irgendwann Spitaldirektorin sein will.
Ganz schön selbstbewusst.
Ja, mein Gegenüber fand das arrogant und hat mir das auch gesagt. Am Ende dieses Gesprächs hatte ich gelernt, wenn man weiss, was man will, ist man arrogant und wenn man mit 21 keinen Plan hat, ist man verpeilt. Jedenfalls bin ich dann recht gefordert worden, konnte im Notfall dann bald einmal ein kleines Team führen. Das hat mir sehr gefallen. Und ich habe viel gelernt.
Konkret?
Es gab einen Professor alter Schule. Wenn ich ihm die Röntgenaufnahmen brachte, fragte er jeweils, «Rytz, was sehen wir?» Ich habe gelernt, genau hinzusehen, zu beschreiben und zu diagnostizieren. Und vor allem: Nicht nur das Offensichtliche in Betracht zu ziehen, sondern das grosse Ganze. Dafür bin ich heute echt dankbar. Mit 27 wechselte ich als Abteilungsleiterin Radiologie in die Klinik «Im Park». Dort hatte ich dann mit einem Chefarzt zu tun, der eigentlich nie nett war, im Gegenteil. Damit habe ich gelernt umzugehen.
Geht das?
Ja, indem man nicht alles an sich heranlässt. Ich habe das im Schockraum in sehr jungen Jahren gelernt und kann das sehr gut. In 95 Prozent der Abende, da ich hier rauslaufe, denke ich nicht mehr ans Geschäft, sobald die Tür zu ist. Ich lasse alles hier.
Und in den anderen fünf Prozent?
Da ist etwas passiert, was mich persönlich betrifft.
Im Alter von 39, mit Zusatzausbildungen im Rucksack, wurden Sie schliesslich Spitaldirektorin.
In der Klinik Belair in Schaffhausen, ein kleines Spital in der Hirslanden-Gruppe, das ein Sanierungsfall war und so gesehen ideal, um das Handwerk der Klinikdirektorin zu lernen. Wir haben Prozesse optimiert und bauliche Massnahmen getroffen, um das Business effizient zu machen. Nach vier Jahren waren wir zurück in der Gewinnzone und ich wäre wohl immer noch da, wäre mein Chefarzt von damals nicht bei mir im Büro gewesen, als ich per Anruf die Anfrage erhielt, ob ich mich in der Schulthess Klinik bewerben möchte – was ich dankend ablehnte. Er sagte nur, «gehts noch, das musst du machen». Und hier bin ich.
Glücklich?
Sehr.
Die Schulthess Klinik gehört einer Stiftung, nicht einem gewinnorientierten Konzern. Da haben Sie sicher viel weniger Druck.
Naja. Wir stehen auf der Spitalliste und müssen daher wie alle anderen Spitäler auch einen EBITDA von mindestens zehn Prozent erreichen. Zudem: Wir finanzieren 34 Forscher mit den Mitteln, die wir im Betrieb erwirtschaften.
Ist das schwierig?
Es ist Arbeit, man muss sich anstrengen. Wir haben in den letzten sieben Jahren hier jeden Stein einmal umgedreht und neu gebaut, Prozesse und medizinische Abläufe neu definiert. So sind wir hocheffizient geworden. Wir arbeiten mit weniger Betten und weniger Personal und haben trotzdem ein Wachstum jedes Jahr von plus drei Prozent.
Auf Kosten von?
In einem Spital verdient man das Geld mit Prozessen. Und verliert Geld mit ineffizienten Prozessstrukturen. Das sind mitunter simple Themen. Ein Beispiel: Früher hat man bei jedem Patienten, der in den Operationssaal kam, einen Schmerzkatheter gelegt. Das machen wir nicht mehr. Wenn Sie Schmerzen haben, kommt unser Schmerzteam und eruiert, was Ihnen in dem Moment hilft. So haben wir alles in der Tiefe neu gedacht – und vieles revolutioniert hier. Noch ein Beispiel: Wir haben damit aufgehört, die Patienten kränker zu machen, als sie sind. Heisst: Unsere Patienten gehen heute zu Fuss in den Operationssaal und werden nicht im Bett reingeschoben. Zwei Stunden nach dem Eingriff steht man bei uns erstmals auf seiner neuen Hüfte und stellt fest, dass sie hält. Dieses Zutrauen beschleunigt den Heilungsprozess.
Was sind heute Ihre grössten Herausforderungen?
Die Preise sind fix. Ich kann nicht sagen, meine Stromkosten sind zehn Prozent höher, ich muss aufschlagen. Es gibt einen Tarif pro Patienten, der ist definiert und fertig. Das gleiche gilt für die EBITDA-Vorgabe von zehn Prozent. Das muss man dann erst einmal umsetzen.
Von wegen steigender Kosten: Die Strompreise sind im Galopp. Was geht in Ihnen vor?
Ich denke, was sind wir doch für coole Typen gewesen, dass wir letztes Jahr eine Flatrate bis 2024 ausgehandelt haben.
Im Ernst?
Ja, so ein Glück. Dazu entschieden wir uns wegen den sehr hohen Corona-Kosten. Ich wollte nicht noch einmal einen Kostenblock haben, der volatil ist. Wir haben die Flatrate auf dem Durchschnitt unseres Stromverbrauchs der letzten drei Jahre fixiert, was aus heutiger Sicht echt sehr cool ist.
Ihr Worst Case?
Menschliches Versagen mit entsprechenden Schlagzeilen in der Presse. Wir sehen pro Jahr 130 000 Patienten, führen 10 000 Operationen durch. Wir sind eine Fabrik. Wir haben alles vorgekehrt, um einen Fall Rosmarie Voser (eine Wirtin aus dem Rafzerfeld, der das Herz einer falschen Blutgruppe implantiert worden war, Anm. der Redaktion), der sich vor bald 20 Jahren im Unispital ereignet hat und an den sich bis heute jeder erinnert, der das mitgekriegt hat, bei uns auszuschliessen.
Wie führen Sie?
Anständig sein, sich nicht so wichtig nehmen, kein Machtgehabe aufführen. Ich habe Menschen gern. Sie interessieren mich und ich glaube Natürlichkeit, Offenheit und Freundlichkeit sind nie falsch, nicht gegenüber einem Arzt, nicht gegenüber einer Reinigungskraft. Ich würde sagen, ich bin sehr zugänglich und präsent, kenne sehr viele der 1250 Mitarbeitenden mit Namen.
Und wie entscheiden Sie?
Ich bin kein Alleinherrscher. Die strategischen und operativen Entscheidungen werden hier am Sitzungstisch in meinem Büro gefällt von sechs Personen.
Wird da auch gerungen?
Natürlich. Ich suche ja auch bewusst Menschen um mich herum aus, die anders denken, die Auseinandersetzung mit einem Thema bringt einen weiter. Wir sind hier alle per Du. Das macht es einfacher damit umzugehen, wenn die Emotionen hoch gehen. Da kann man auch mal sagen, hey, chill mal, trink einen Kaffee und beruhige dich. Dann diskutieren wir weiter, bis es gut ist und damit erledigt. Den Spruch: «Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende» würde ich sofort unterschreiben.
Wie realistisch ist eigentlich die Serie «Grey’s Anatomy»?
Sehr. Ich könnte darüber ein Buch schreiben.
Und was hat es mit der Männerdomäne auf sich?
Eine Anekdote: Als ich hier beim Vorstellungsgespräch war, bin ich von einem Arzt am Tisch gefragt worden, ob ich ein Problem damit habe, eine Frau zu sein. Ich dachte, was für eine Frage, wir haben 2015! Ich habe geantwortet: Weiss nicht, ich war noch nie ein Mann. Aber wissen Sie, wenn ich Ihre Chefin werden sollte, hätte ich ein Problem mit Ihrer Ausdrucksweise. Daran müssten wir sofort arbeiten. Die Antwort auf Ihre Frage: Eine Frau zu sein, war für mich immer ein Vorteil und ich habe mir das zunutze gemacht, ist ja nicht mein einziger USP.
Ihr nächstes grosses Projekt?
Mein Mann und ich machen eine Weltreise. Dreieinhalb Monate.
Wer schmeisst die Klinik?
Meine Stellvertreterin.
Nervös?
Nervös machen würde es mich, wenn ich keine Stellvertretung hätte, die funktioniert, da müsste ich mich fragen, was ich alles falsch gemacht habe. ★
Foto: Schulthess Klinik