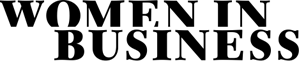Ann Demeester will als neue Direktorin des Zürcher Kunsthaus das Haus öffnen, der Kunst vermehrt auch gesellschaftliche Fragen stellen und neue Besucherschichten anlocken. Mit ihren Visionen weckt die Belgierin hohe Erwartungen.
Eine Frau wird in die oberste Führungsetage eines der wichtigsten Schweizer Kunstmuseen geholt und ist fest entschlossen, das Haus zu öffnen, kritische Fragen zu stellen, neue Besucher zu holen. Sie will neue Wege gehen, wie mit Kunst mit teilweise fragwürdiger Provenienzgeschichte – Stichwort Sammlung Bührle, Nazi-Fluchtkunst – umgegangen wird. Sie will den Kanon neu präsentieren. Sie will auch Leute mit Migrationshintergrund und Expats ins Haus locken oder Leute, die mit Kunst nichts zu tun haben.
Der frische Wind, der durch die erlauchten Hallen des Chipperfieldbaus (und auch des alten Kunsthauses) wehen soll, ist bereits zu spüren, wo immer die belgische Literaturwissenschafterin und Museumsfrau mit den langen braunen Haaren anzutreffen ist; in zahlreichen Presseinterviews, in denen ihr frischer Blick zu spüren ist (und für die sie auch einmal ein Modeshooting vor ausgesuchter Kunst absolviert) oder an Podiumsgesprächen.
Am traditionellen Neujahrsmeeting des Tages-Anzeigers in Zürich überraschte sie die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur mit ihrem ungewohnten Zugriff auf Kunst, Witz und Charme. Eines ihrer Lieblingsthemen scheint zu sein, welch positiven Effekt Kunst und Kreativität in überraschenden Settings haben können. Sie erzählte davon, wie in den USA bei Medizinstudierenden und bei der Polizei Kunstbetrachtung in die Schulung integriert wird. Für Demeester geht die Funktion von Kunst weit über ihre Rolle als Selbst – bestätigung für ein elitäres, bildungsbürgerliches Publikum hinaus. Sie attestiert Kunst geradezu heilende Eigenschaften. Auch in den Arbeitsalltag im Kunsthaus bringt sie frischen Wind. Mit ihrer nahbaren Art motiviert sie ihre Mitarbeiter neu; sie organisiert Teamsitzungen, bringt Teilnehmer aus verschiedensten Abteilungen zusammen und bricht Kästchendenken auf.
Demeester ist eine Changemakerin, die etwas riskieren will. Im Herzen des kulturellen Zürichs denkt eine Belgierin über nichts weniger nach, als wie das Kunsthaus eine neue Rolle in der Gesellschaft einnehmen kann.
WOMEN IN BUSINESS: Sie sind Belgierin, sind im Juli von Holland in die Schweiz gezogen. Wie arbeitet man sich in eine neue Mentalität und Kultur ein?
Ann Demeester: Mit profundem Desk Research und mit vielen Gesprächen. Anders als ein Expat, der mit einem Welcome-Paket empfangen wird, muss sich das bei mir als organischer Prozess entwickeln. Mir war wichtig, viel Historisches zu lesen, wobei sich viel auf die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs konzentriert hat, auch wegen der Diskussion um die Impressionisten-Sammlung von Emil Bührle, die wir als Leihgabe im Haus haben. Ich las vom «Handbuch der neuen Schweiz» über ein Kinderbuch über Schweizer Geschichte bis zu Fachbüchern wie «Kunst, Krieg und Kapital» und «Das kontaminierte Museum». Während man als Einheimische über viel unbewusstes Wissen verfügt, muss ich mir vieles erst aneignen. Für mich ist jeder Tag eine Lernkurve.
Wie fremd kommt Ihnen denn Ihr neuer Arbeits- und Wohnort vor?
Das Ausländerdasein bin ich gewohnt. Ich war ja als Belgierin schon in Holland Ausländerin. Ich weiss, wie es ist, sich auf eine vollkommen andere Kultur einzulassen. Ich sage immer, Belgien ist ein Patchwork aus verschiedenen Kulturen, wo man wie in einer WG zusammenlebt. Man teilt sich vielleicht Küche und Badezimmer, aber nicht mehr. Das ist vielleicht ähnlich wie in der Schweiz. Das hilft mir, mich hier einzuleben.
Sie sind weder in einem kunstaffinen Haus aufgewachsen, noch haben Sie Kunstgeschichte studiert. Wie wird man trotzdem Direktorin eines Kunstmuseums?
Ich hatte keinen Plan. Mein Weg entwickelte sich organisch, indem ich immer meine Interessen verfolgte, und ich das Glück hatte, dass sich Chancen ergaben. Meine Eltern waren zwar nicht kunstaffin, aber ich bin in einem Bildungssystem aufgewachsen, das mir viel Kultur bot. Ich wusste lange nicht, was ich machen wollte, aber ich war ein Bücherwurm und interessierte mich für das Reich der Fiktion, die parallele Realität der Imagination. Die habe ich dann in der Literatur und im Theater gefunden, aber auch in der Kunst und im Tanz.
Was interessiert Sie daran?
Mich faszinieren Parallelwelten. Darin machen Künstler Vorschläge, wie man die tägliche Realität anders sehen kann. Ich schloss dann ein weiteres Studium in Cultural Studies an und arbeitete ein paar Jahre als Literaturjournalistin, schrieb aber zunehmend auch über Kunst. Eines Tages rief mich dann Jan Hoet, der Direktor des SMAK-Museums an und fragte, ob ich seine Assistentin werden wollte. So rutschte ich in die Museumswelt hinein und begann, zu kuratieren.
Museumsarbeit setzt sich aus vielen verschiedenen Disziplinen zusammen. Welche gefällt Ihnen am besten?
Was ich am meisten liebe, ist die Vermittlung der Kunst. Das Management macht zwar jetzt 80 Prozent meiner Arbeit aus, aber mein Ziel bleibt es, Begeisterung für die Kunst zu wecken. Ihr Spezialgebiet an der Universität war postkoloniale englischsprachige Literatur in Indien. Die postkoloniale Sichtweise, damals eher ein Nischenthema, ist heute im Brennpunkt vieler Diskussionen, auch in der Schweiz. Das stimmt. Dieses Studium hat bei mir denn auch den Blick früh dafür geschärft, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer unseres eurozentrischen Blicks bewusst sein müssen. Es geht nicht um Schuld. Es geht darum, dass man dieses Bewusstsein hat, dass die Kolonialgeschichte uns nicht nur geprägt hat, sondern dass dieses imperiale Denken nach wie vor vorhanden ist. Dieses Bewusstsein musste ich mir nicht erst jetzt frisch anlernen, sondern war für mich früh schon eine natürliche Haltung, die in meine Ausstellungspraxis immer hineingespielt hat.
Als Direktorin am Frans Hals Museum stellten Sie die niederländischen Meister in den Kontext von Kolonialismus. Welche Kontexte gäbe es denn in Zürich, der Schweiz zu untersuchen?
In Holland habe ich zeigen wollen, dass das vielbeschworene «Goldene Zeitalter» niederländischer Kunst nur mit Kolonialismus, Sklaverei, aber auch Handel entstehen konnte. Wenn Holland kein Imperium gewesen wäre, sähe man auf Stillleben nur Käse, Äpfel und Milch, und kein Porzellan, keine persischen Teppiche und exotischen Pflanzen! In der Schweiz fasziniert mich, welche Rolle die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs gespielt hat und, breiter gefasst, was Neutralität in der Vergangenheit und heute bedeutet. Mit der Sammlung Bührle haben Sie ein gutes Beispiel, an dem sich diese Frage aufarbeiten lässt. Mit dieser Sammlung sind viele komplexe und umstrittene Themen verknüpft, die aber gleichzeitig eben auch viel über das Selbstverständnis der Schweiz aussagen. Der Umgang mit der Sammlung Bührle provozierte einen Skandal, aber ich sehe sie eben auch als eine Möglichkeit, bei historischen und gesellschaftlichen Themen anzuknüpfen. Ich finde nicht, dass Kunst damit nichts zu tun hat. Kunst hat sehr viel damit zu tun, und Bührle ist ein Pars pro Toto. Es geht um Waffenhandel mit den Nazis, aber auch darum, dass ihn der Schweizer Staat ermöglicht und wirtschaftlich sogar davon profitiert hat, obwohl er neutral war. Das ist ein relevantes Thema, das auch das Kunsthaus angehen muss. Mit dem im Hinterkopf machen wir in diesem Jahr eine neue Ausstellung.
Schweben Ihnen weitere Themen vor, die in einem gesellschaftlichen Bezug stehen?
Ja, zum Beispiel das Thema der Neutralität. Was bedeutet sie? Sie ist Teil der nationalen Identität, aber sie ist ein Konstrukt. Was bedeutet sie in der heutigen Welt, wie wird sie in der Kunst reflektiert? Eine weitere Baustelle nicht nur am Zürcher Kunsthaus ist die Repräsentanz von Frauen in Sammlungen und Ausstellungen. Am Zürcher Kunsthaus wurden nur elf Prozent der Sammlung von Künstlerinnen geschaffen, und es gab in vielen Jahren nur einen Bruchteil von Einzelausstellungen, die Frauen gewidmet waren.
Es gibt doch jetzt auch viele Neuentdeckungen und Neuevaluierungen?
Ja, überall werden jetzt auch historische weibliche Positionen neu entdeckt. Wir werden nächstes Jahr zum Beispiel Suzanne Duchamp in einer kleinen Präsentation zeigen. Aber jede historische Sammlung wird letztlich eine Dominanz von weissen Heteromännern beibehalten, an der man nichts mehr ändern kann. Man kann Figuren neu entdecken, aber auch durch retrospektive Ankäufe lässt sich das Ungleichgewicht nicht mehr ändern. Was die Gegenwartskunst betrifft, haben wir auf ein natürliches Geschlechtergleichgewicht geachtet, ganz ohne Quote, aber als Antwort auf das breite Spektrum an aussergewöhnlichen Künstlerinnen, die wir heute in der Welt sehen. Wir werden auch Künstlerinnen einladen, mit unserer Sammlung in Dialog zu treten, ihr eine andere Stimme entgegensetzen.
Das Museum als Institution hat in den letzten Jahren eine grosse Entwicklung erlebt. Wie sehen Sie seine Rolle?
Idealerweise ist ein Museum für mich ein Zentrum der Neugier. Früher, zur Zeit der Aufklärung, gab es ja diese Wunderkammern, wo – auch imperialistische – Neugier befriedigt wurde. Heute sieht man das Museum nicht mehr nur als Hort von Objekten, sondern auch von Ideen und Erzählungen. Ich betrachte es als unsere Aufgabe, Neugier zu stimulieren und verschiedene Diskussionen anzuregen. Man muss nicht zwangsläufig alles besitzen, sondern es gibt auch andere Formate, etwa Performances oder Debatten. Dabei können wir immer noch ein Bilderpalast sein, aber einer, den wir aufmischen und der durchlässig wird.
In welche Richtung denken Sie da?
Eine Metapher, die hier allerdings nicht so gut aufgenommen wurde, ist für mich ein Tempel auf Bali. Der Tempel wird dort ganz selbstverständlich in den Alltag integriert. Man kommt dorthin, um die Götter zu verehren, aber auch, um die Familie zu treffen, zu essen und zu reden. Dafür, dass das «Castle on the hill» zu einem Zentrum der Neugier umgebaut wird, bedarf es aber viel Arbeit von unserer Seite.
Wenn die Rolle des Museums ändert, streben Sie damit auch andere Besucher an?
Gerade, weil ich nicht aus einer kunstaffinen Familie stamme, liegt mir sehr am Herzen, dass auch Menschen einen Zugang finden, die noch keine Beziehung zur Kunst haben. Ich weiss aber aus Erfahrung, dass man andere Gemeinschaften nicht so leicht erreicht. Wir haben ihnen zwar viel zu bieten, aber sie müssen es auch wollen. Ich wohne in Altstetten, und da gibt es viele Schweizer, deren Familien ursprünglich aus Ex-Jugoslawien stammen. Ich bin gespannt, wie viele von meinen Nachbarn ins Kunsthaus kommen. Es gibt in Zürich viele Secondos, es gibt Expats, die für Unternehmen wie Google arbeiten. Es braucht viel Zeit, herauszufinden, wie man diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreicht. Es reicht nicht, dass man ihnen nur die Türe öffnet. Es braucht Ideen und spezielle Programme.
Sie wollen die Kunst also vom Sockel holen. Soll sie nicht mehr etwas Spezielles sein?
Sie stellen eine Grundsatzfrage, mit der sich Museen heute befassen müssen. Kunst ist etwas Spezielles, aber sie soll nicht exklusiv sein! Es braucht kein Vorwissen, um der Kunst zu begegnen. Kunst ist nicht nur für Insider. Kunst ist kein Sudoku, das man lösen muss! Ich bin der lebende Beweis dafür. Es geht darum, den Kontakt aufzunehmen und offen zu sein, dann kann jeder mit einem Kunstwerk eine Begegnung haben. Aber man muss sich Mühe geben, offen zu sein, denn ab und zu ist Kunst komplex.
Drehen wir den Uhrzeiger der Zeit ins Jahr 2030. Was wäre Ihre Zukunftsvision für das Kunsthaus? Freies Fantasieren ist erlaubt!
Wenn ich wirklich fantasieren darf, dann wäre mein ideales Kunsthaus mit einem Wellness Center verbunden. Das hört sich idiotisch an, aber wenn man diese Offenheit haben will, von der ich gesprochen habe, dann muss man entspannt sein. Und wo entspannt man sich besser als in einer Sauna oder einem Hammam, wo man auch den Körper trainieren kann? ★
Ann Demeester
Ann Demeester, geboren 1975 in Brügge, ist seit dem 1. Oktober 2022 Direktorin des Zürcher Kunsthauses. Sie studierte Germanistik an der Universität Gent und Kulturwissenschaften an der KU Leuven. Sie arbeitete zunächst als Journalistin und Literaturkritikerin, bevor sie Assistentin des renommierten belgischen Museumsdirek – tors und Kurators Jan Hoet wurde. Unter seiner Leitung kuratierte sie Ausstellungen in Belgien, u.a. im Stedelijk Museum in Gent, wie auch in Deutschland am Marta Herford. 2006 bis 2014 leitete sie das Amsterdamer Kunstzentrum Appel Arts Centre, ab Februar 2014 Direktorin des Frans Halsmuseum / De Hallen in Haarlem.
Aktuelle Ausstellungen im Kunsthaus Zürich:
- Füssli. Mode – Fetisch – Fantasie. (Bis 21. Mai.)
- Re-Orientations. Europa und die islamische Künste, 1851 bis heute. 24. März bis 16. Juli.
- Plus: Werke aus der Video-Sammlung und dialogische Gegenüberstellungen zeitgenössischer Werke von u.a. Kader Attia, Nathalie Djurberg und Judith Bernstein in den Sammlungsräumen.
Foto: © Franca Candrian, Kunsthaus Zürich