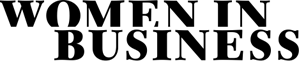Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändert sich die Arbeitswelt und mit ihr unser Berufsleben. Theo Wehner, Arbeits- und Organisationspsychologe und langjähriger Professor an der ETH, über unseren Umgang mit Technologien, lebenslanges Umlernen und die Kreativität, sich immer wieder neu zu erfinden.
Women in Business: Automatisierung und künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Was tun wir in Zukunft, wenn uns Maschinen am Arbeitsplatz zunehmend Arbeiten abnehmen und unsere Arbeit wegrationalisiert wird? Ein grosser Wandel besteht darin, dass wir nicht mehr an einer einzigen Karriere festhalten werden. Früher ging man ein Leben lang einem Beruf nach. Er war Identitäts- und persönlichkeitsstiftend. Mit den Veränderungen in der Arbeitswelt, mit Projektarbeit und zeitbefristeten Jobs ändert sich das Profil. Schon heute haben die Menschen beispielsweise in den USA zwei oder drei Arbeitgeber. Künftig ist viel mehr Kreativität erforderlich, um sein Arbeitsleben zu gestalten und durch die Tätigkeit, nicht unbedingt durch den Beruf, Stolz zu gewinnen.
Das erfordert ein hohes Mass an Flexibilität und Findungsreichtum vom Einzelnen.
Genau. Wir waren es uns bisher gewohnt, dass man eine Ausbildung und Wissen bevorratet hat. Heute ist mein Wissen nur noch so viel wert, wie ich anschlussfähig bin und jemand dieses Wissen überhaupt braucht. Ich muss mich also immer wieder adaptieren.
Und wie halte ich mich «anschlussfähig»? Der Ruf nach lebenslangem Lernen ist schon heute laut. Heisst das, dass wir uns dauernd weiterbilden müssen?
Lebenslang lernen tönt mir zu sehr nach lebenslänglicher Strafe, wie eine Drohung. Es wird viel stärker um ein Learning by doing gehen, um ein Umlernen am Arbeitsplatz. Da ist eine ganz andere psychische Energie erforderlich als beim Neulernen im Rahmen einer klassischen Ausbildung. Vor allem heisst das, dass es wichtiger wird, situativ-reflexiv zu handeln. Nicht nur flexibel sein, sondern die Situation und den Kontext genau betrachten und reflektieren. Keine Maschine kann das! Und es bedeutet, dass man nicht einfach eine Ausbildung macht und dann im Beruf die Kompetenzen langsam aufgebraucht werden. Es geht in Zukunft zwei Schritte vorwärts, einen zurück, drei zur Seite, dann wieder nach vorne, und vielleicht kommt ein Luftsprung!
Sie beschreiben ein Zukunftsszenario, in welchem das Arbeitsleben in voneinander getrennten Etappen stattfindet und sich mit Pausen, Regenerierungs- und Umorientierungsphasen abwechselt. Tatsächlich werden Ausbildungen kürzer und nicht mehr so fest an Strukturen gebunden sein. Das ist auch sinnvoll. Es wird vielmehr auf den Einzelnen ankommen, was er lernen will, statt auf das Curriculum, das eine Institution vorgibt. Der Einzelne wird stärker an seiner Ausbildung mitarbeiten, er wird seinen Bildungsbedarf laufend selbst bestimmen. Bildungsexperten haben lange genug danebengelegen. Es wird Zeit, dass wir uns den Bildungsbedarf selber erarbeiten.
Vielen macht die Selbstständigkeit aber auch Angst. Sie brauchen Sicherheit.
Der Wunsch nach dem sicheren Arbeitsplatz ist, bei aller Wertschätzung, eine statische Sicht. Sie ist eine Erhaltungs- und nicht eine Ermöglichungssicht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass wir ein Recht auf einen Arbeitsplatz haben. Das 21. Jahrhundert wird über kurz oder lang eine Trennung von Arbeit und Einkommen erleben. Die Technologisierung am Arbeitsplatz führt zu Rationalisierung. In kürzerer Zeit wird mehr von immer weniger Erwerbstätigen erledigt. Technikeinsatz führt zu Verdichtung in nicht gekanntem Ausmass.
Warum arbeiten wir dennoch alle gefühlt mehr? Der Technikeinsatz führte bisher zu Be- und nicht zu Entschleunigung oder zu mehr Musse. Dieser Umgang mit Technologie ist ja nicht gottgegeben! Ein Smartphone oder eine App könnten ja Chancen zu mehr Freiraum bieten. Der Gebrauch von Geräten liegt nicht in der Technik, sondern daran, wie wir sie benutzen. Wenn wir Kommunikationstechnik wie eine elektronische Hundeleine handhaben, dann haben wir dieses Element in die Technik gelegt. Nicht die Technik schreibt das vor.
Rationalisierung bedeutet, dass es weniger Arbeit gibt. Sehen Sie darin einen Segen und eine Befreiung – oder einen Fluch?
Zunächst ist die Technologisierung und Rationalisierung ja nichts Neues. Der Drang zur Automatisierung wohnt dem Menschen schon seit archaischen Zeiten inne. Was neu hinzugekommen ist, ist die Vernetzung, die Verdichtung, die Reduktion und die enorme Beschleunigung. Sie wird uns von der Arbeits- in eine Tätigkeitsgesellschaft überführen. Die Arbeitszeit hat sich bereits in den vergangenen Jahren in allen Industrieländern stark reduziert. Wir produzierten vor 30 Jahren mit der doppelten Beschäftigungszahl das Gleiche, was wir heute produzieren. Diese Entwicklung schreitet weiter voran.
Das bedeutet: mehr Freizeit, mehr Freiheit – nur, wovon leben wir dann?
Die Zwangskopplung des Erwerbs an die Arbeit wird sich lockern. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, darüber nachzudenken, wie Menschen ihre Existenz sichern, wenn es immer weniger Arbeit gibt. Ich denke an das bedingungslose Grundeinkommen. Arbeitsgesellschaften haben nie eine Vollbeschäftigung gehabt. Heute werden weit über ein Drittel der Arbeitsfähigen subventioniert. Es muss einen gerechteren Verteilschlüssel geben, der erlaubt, dass man Einkommen von der Arbeit trennt. Wenn wir heute in der Lage sind, das zu produzieren, was früher mit der doppelten Arbeitskraft hergestellt wurde, muss man sich fragen, wo das Geld, das durch die Rationalisierung gewonnen wurde, hingeflossen ist. Die Frage ist: Was leistet eine Arbeitsgesellschaft und für wen? Es geht um Verteilungsmechanismen. Warum wird die Arbeit besteuert, warum haben wir keine Maschinensteuer? Das sind Anachronismen, über die gesprochen werden müsste.
Wenn dieses Problem gelöst ist, haben wir noch das «Problem» mit der freien Zeit. Bezieht der Mensch durch seine Arbeit nicht auch Sinnerfüllung? Was machen wir dann mit der freien Zeit? Ich hätte jedenfalls keine Sorge, dass weltweit die Hängematten aufgespannt würden. Der Mensch ist von Natur aus ein tätiges Wesen! Es ist ein Grundbedürfnis, und zwar nicht nur, um den eigenen Neigungen nachzugehen. Auch um sich sozial zu betätigen, etwa in Freiwilligenarbeit. Sie führt zu grosser Befriedigung und – wie unsere Forschung gezeigt hat – zu einer positiven Work-Life-Balance. Unsere hochentwickelte, verdichtete, durchrationalisierte und stressdominierte Arbeitsgesellschaft hat mit Mobbing hingegen eine absolut asoziale Form von Zusammenarbeit hervorgebracht. Der Plattformkapitalismus führt teilweise zu Formen von Selbstausbeutung, durch die Gig-Economy etwa. Die Tätigkeitsgesellschaft wird die sozialen Aspekte des Tuns und die Sinnerfüllung vermehrt betonen.
Wie sähe also in Ihren Augen die Zukunft der Arbeitsgesellschaft aus?
Wenn Einkommen und Arbeit getrennt wären, könnten die Menschen Tätigkeiten nachgehen, die sie wirklich innerlich befriedigen und ihnen sinnvoll erscheinen. Der Anspruch, eigene Ideen in den Arbeitsprozess einfliessen zu lassen, wird ebenfalls zunehmen. Statt um vertikalen Aufstieg ginge es mehr um horizontale Weiterentwicklung. Das heisst, ich betätige mich auf verschiedene Art und Weise: mal im Team, mal im Homeoffice, mal handwerklich, dann wiederum als Teamleiter. Dabei kann es auch mehr um Identitätsbildung gehen als um die Karriere.
Frauen wird ja gemeinhin ein grösseres Talent im Multitasking nachgesagt, weil sie durch die Verbindung von Arbeit mit Betreuungsaufgaben – sei es von Kindern oder Eltern – mehr gewohnt sind, verschiedenen Anforderungen nebeneinander zu genügen. Wird die sogenannte Tätigkeitsgesellschaft also weiblicher? Das situativ-reflexive Moment ist Frauen tatsächlich in höherem Masse eigen. Wenn Sie – ob Frau oder Mann – sich Erziehungs- oder Betreuungsaufgaben widmen, müssen Sie sich immer wieder auf Dinge einlassen, die Sie nicht geplant haben, und sich situativ anpassen. Wenn ich zum Beispiel Freiwilligenarbeit betrachte, sehe ich Männer, die die Arbeit im Sitzen erledigen – ich denke an die typische Vorstandsarbeit. Derweil handeln die Frauen und organisieren den ganzen Rest. Wenn die sozialen Aspekte in der Tätigkeitsgesellschaft wichtiger werden, dann sind die traditionell den Frauen zugeschriebenen Tugenden tatsächlich besonders geeignet. Bisher hat die Arbeitswelt zwar den Frauenanteil erhöht, aber nur mit einer gewissen Anpassungsleistung der Frauen an die männlichen Attitüden.
Sie sind Forscher. Wären Sie aber Mitarbeiter in einem Unternehmen, wie würden Sie sich für die Zukunft rüsten? Ich würde Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten kultivieren. Jeder, der heute nur schon fünf oder zehn Jahre in der Berufswelt stand, hat schon Veränderungen gemeistert. Ich würde mir genau überlegen, wie ich diesen Wandel gemeistert habe und wo ich Probleme hatte. Es braucht Offenheit gegenüber Veränderungen und ein stärkeres Selbstbewusstsein gegenüber der Techniknutzung. Heute kommt es mir manchmal vor, als wären wir von Scham besetzt, dass unsere Geräte uns überlegen sind. Das ist keine günstige Voraussetzung, um sich Technik anzueignen. Nicht diese Geräte haben uns gemacht, sondern wir sie! Ich denke, wir müssen uns genau überlegen, wo und mit welcher Geschwindigkeit wir sie einführen wollen. In Zukunft eine gewisse Souveränität gegenüber der Technikentwicklung und deren Gebrauch zu erhalten, erscheint mir zentral.
Theo Wehner
1949 in Fulda (D) geboren, studierte Psychologie und Soziologie und promovierte an der Universität Bremen. Seit 1997 ist er an der ETH Zürich. Einen Schwerpunkt bilden Forschungsprojekte zur Sicherheit und Fehlerfreundlichkeit in der Arbeitswelt und zur Freiwilligentätigkeit. Wehner ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und eine Enkelin.