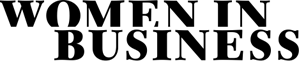Mit dem neuen Lehrstuhl für Gendermedizin nimmt die Universität Zürich in der Schweiz
eine Pionierrolle ein. Massgeblich daran beteiligt: Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer, Direktorin Universitäre Medizin. Ein Gespräch über Geschlechtsunterschiede.
Im Jahr 1865 erteilte die Universität Zürich als erste Hochschule im deutschen Sprachraum Frauen die Zulassung zum Studium. Die Russin Nadeschda Prokofjewna Suslowa promovierte als erste Frau an der medizinischen Fakultät und meinte seinerzeit: «Ich bin die Erste, aber nicht die Letzte. Nach mir werden Tausende kommen.» Sieben Jahre später absolvierte schliesslich die erste Schweizerin, Marie Heim-Vögtlin, ihr medizinisches Staatsexamen, um später als Gynäkologin tätig zu sein.
Auch Beatrice Beck Schimmer liebäugelte bereits in jungen Jahren mit einem Medizinstudium, da sie sich für die Biologie des Menschen und für das Zusammenspiel der Organsysteme interessierte. Entschieden wie sie war, folgte sie ihrer inneren Stimme und schrieb sich an der Universität Bern ein. Nach erfolgreicher Beendigung ihres Studiums sei sie jedoch auch mit Vorurteilen gegenüber weiblichem Fachpersonal konfrontiert worden, sagt sie rückblickend: «Als ich als Notärztin einen Patienten behandelte, erkundigte sich dieser nach einem Arzt. Das habe ich aber weggesteckt.» Weitaus schwierigere Erfahrungen sammelte Beatrice Beck Schimmer als Assistenzärztin, in einer Zeit, als sie rund um die Uhr arbeitete und zunehmend der Wunsch nach einer gesunden Work-Life-Balance aufkam. Ihr Chef setzte eine Verbesserung der Situation in Aussicht, doch nichts geschah. «Das führte dazu, dass ich ein Angebot des Zürcher Univer- sitätsspitals annahm und einen Neuanfang als Anästhesistin wagte. Mein Vorgesetzter goutierte meine Kündigung keineswegs, sprang sogleich vom Stuhl auf und entgegnete: ‹Das ist das letzte Mal, dass ich eine Frau angestellt habe.› Einige Zeit später berücksichtigte er erneut Medizinerinnen, doch dieses Erlebnis setzte mir längere Zeit zu.»
Women in Business: Sie sind als Direktorin Universitäre Medizin an der Universität Zürich tätig. Wie erleben Sie heute die Stellung der Frau im Rahmen Ihrer Fakultät?
Beatrice Beck Schimmer: Seit 2005 schliessen mehr Frauen als Männer das Medizinstudium ab. Letztes Jahr lag der weibliche Anteil gar bei 61,1 Prozent. Im kommenden Herbst werden rund 430 Studierende erwartet. Die Universität Zürich ist gefordert, nicht nur Ärztinnen und Ärzte auszubilden, sondern auch mehr Professorinnen zu berufen. In den oberen Hierarchien sind die- se nach wie vor untervertreten. Ich persönlich befürworte, dass wir Frauen nicht für eine Männerwelt «zurechtgetrimmt» wer- den, sondern einen Kulturwandel herbeiführen.
Wie muss man sich einen solchen Entwicklungsprozess vorstellen?
Kurz nach meinem Stellenantritt habe ich das Projekt «Re-De- sign-Berufungen» ins Leben gerufen, unter anderem mit dem Ziel, den Anteil der Professorinnen zu erhöhen. In einem ersten Schritt sollte die Klinikstruktur des jeweiligen universitären Spitals diskutiert und angepasst werden. So können beispielswiese grosse Einheiten in drei oder vier fachspezifische Gruppen unterteilt werden, was dazu führt, dass nicht lediglich eine Person für rund 60 Medizinerinnen und Mediziner zuständig ist. Die Reduktion der Führungsspanne führt zu flacheren Hierarchien. Neu führt das Dreier- oder Vierer-Gremium die Klinik, wobei eine Person für eine bestimmte Dauer den Vorsitz übernimmt. In zwei Pilotprojekten im Bereich Anästhesiologie und Viszeral- sowie Transplantationschirurgie werden die Strukturanpassungen inklusive Definition neuer Führungsrollen umgesetzt.
Trauen sich Frauen Führungsaufgaben weniger zu?
Ich denke nicht. Institutionen müssen jedoch ein attraktives Umfeld schaffen, das auch Frauen motiviert und unterstützt, Führungsaufgaben wahrzunehmen. An der Medizinischen Fakultät steht das Direktorium in engem Austausch mit der vor zwei Jahren gegründeten Chancengleichheitskommission. Diese hat verschiedene Massnahmen zur Schaffung einer positiven Ambiance erarbeitet, indem unter anderem biologische und soziale Komponenten von Geschlecht in Lehre und Forschung einbezogen werden. Professorinnen dienen zudem als Vorbilder für die jüngere weibliche Generation. Ich selbst bin regelmässig als Mentorin tätig und begleite dabei eine Nachwuchskraft auf ihrem akademischen und beruflichen Weg. Derzeit sind drei Frauen in der Universitätsleitung vertreten. Dadurch widerspiegeln wir nicht nur die Geschlechterverhältnisse, sondern motivieren auch andere, unserem Beispiel zu folgen.
Wo besteht noch Verbesserungspotential in Bezug auf leitende Funktionen?
Die geschlechtsspezifischen Vorurteile müssen beseitigt werden ebenso wie Stereotypen. Das Ziel besteht darin, eine unterstützende und inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen. Aussagen von Berufskollegen wie: «Ich möchte dir helfen» dürften in diesem Zusammenhang nicht förderlich sein, da sie nur starre Vorstellungen im Zusammenhang mit Frauen bedienen. Umso wichtiger ist eine offene und respektvolle Kommunikation. Es wäre ausserdem wünschenswert, wenn Männer in höheren Positionen mehr auf die weiblichen Anliegen eingehen würden. Hiermit spreche ich gewisse Machtspiele und intransparentes Verhalten an, das einer konstruktiven Zusammenarbeit oft im Wege steht.
Nebst dem Beruf kommen meist noch familiäre Verpflichtungen hinzu. Wie ist es Ihnen als zweifache Mutter gelungen, Vollzeit zu arbeiten?
Ein tragendes Netz von externen Mitgliedern und Familie sowie eine solide Partnerschaft stellen einen erheblichen Vorteil dar, was bei mir der Fall war. Auch bekam ich die Möglichkeit, in der Klink ein Teilzeitpensum auszuüben, um meine Forschungsarbeit vorantreiben zu können. Das hat mich wiederum motiviert, das Laufbahnförderprogramm «Filling the Gap» mit einer finanziellen Unterstützung von nahezu einer Million Franken pro Jahr auf die Beine zu stellen, mit dem Bestreben, insbesondere Frauen im Rahmen von geschützter Forschungszeit zu unterstützen. Inzwischen bieten die Hochschulen und universitären Spitäler viele unterstützende Instrumente an, die junge Medizinerinnen nützen sollten. Das kann von einer Beratung in der Abteilung Gleichstellung bis hin zur Bewerbung eines Laufbahnförderprogramms reichen. Auch ist es ratsam, private und berufliche Kontakte zu pflegen. Nicht selten trifft man dabei auf Gleichgesinnte. Und, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
Sie haben in den USA in einem Grundlagenlabor gearbeitet, bauten später eine Forschungsgruppe auf und waren als Forschungsrätin beim Schweizerischen Nationalfonds tätig, bis Sie schliesslich zur Direktorin Universitäre Medizin ernannt wurden. Sind Sie bewusst auf eine leitende Funktion zugesteuert?
Eigentlich nicht. Vielmehr hat man mich angefragt, ob ich mich für besagten Posten bewerben möchte. Allerdings handelte es sich um eine reifliche Überlegung. Es war eine schwierige Diskussion, die ich mit mir selbst und meiner Familie geführt habe, denn ich war eigentlich sehr zufrieden mit meiner Forschungstätigkeit und jener als Leitende Ärztin. Letztendlich packte ich die Herausforderung an, zumal ich gerne strategisch agiere. Übrigens habe ich mich bereits als Prodekanin für Chancengleichheit eingesetzt, und da spielt auch die Gendermedizin als Teil der Präzisionsmedizin eine wichtige Rolle.
Die Universität Zürich führt als erste Hochschule der Schweiz einen Lehrstuhl für Gendermedizin ein. Die Schweiz hinkt im internationalen Vergleich allerdings hinterher.
Die USA und Kanada beschäftigen sich schon längere Zeit mit geschlechtergerechten Forschungsprogrammen und sind deshalb bereits weit fortgeschritten. Auch Länder wie Österreich und Deutschland schreiten stetig voran. Umso wichtiger ist es, dass die Schweiz den Anschluss nicht verliert. Die personalisierte Medizin beschäftigt Universitäten und Universitäts- spitäler seit einigen Jahren mit dem damit verbundenen Ziel, Patientinnen und Patienten eine präzise Diagnostik, passende Therapien und dadurch eine verbesserte Lebensqualität anbieten zu können. Im kommenden Jahr werden wir den neuen Lehrstuhl für Gendermedizin einberufen, um Geschlechterunterschiede zu erforschen und in Lehre und Praxis einzubringen. Es handelt sich um eine Vision für den Medizinstandort Zürich bestehend aus einem grossen Netzwerk, zu welchem die vier universitären Spitäler Balgrist, das Kinderspital, das Universitätsspital sowie die Psychiatrische Universitätsklinik gehören. Allzu lange ist übersehen worden, dass sich Frauen von Männern unterscheiden und bei bestimmten Krankheiten andere Symptome aufweisen sowie eine andere Medikamentendosierung benötigen.
Frauen haben bei gleichen Diagnosen weniger gute Chancen, intensivmedizinisch betreut zu werden als Männer. Woran liegt das?
In der Schweiz werden geschlechtsspezifische Aspekte in klinischen Studien und der Grundlagenforschung bisher weitgehend vernachlässigt. Die wenigen vorhandenen Erkenntnis- se baut man kaum in die klinische Routine ein, obwohl eine wachsende Anzahl von Studien belegt, dass ein geschlechtsneutrales Universalkonzept in der Erforschung und Behandlung von Krankheiten nicht sinnvoll ist. Fazit: Eine fehlende Geschlechterperspektive in der Forschung führt zur Abkopplung von wissenschaftlichem Fortschritt. In der Klinik besteht insbesondere die Gefahr von verfehlten Diagnosen und Behandlungen. Und die Versorgung verteuert sich unnötig, wenn sie sich nicht spezifisch an ihre Zielgruppen wendet.
Wurden auch kritische Stimmen in Bezug auf den neuen Lehrstuhl laut?
Die noch wenigen Erkenntnisse im Bereich der Gendermedizin sind noch lange nicht in allen Fachbereichen vorhanden. Allerdings stehen nicht alle Medizinerinnen und Mediziner Veränderungen positiv gegenüber.
Gibt es weitere Hürden zu meistern?
Am Medizinstandort Zürich ist es wichtig, dass die gendermedizinischen Aspekte in die Versorgung einfliessen. Das Universitätsspital Zürich plant deshalb, ein interdisziplinäres Frauengesundheits-Center «Women’s Health Center» aufzubauen. Gerade im ambulanten Bereich des Universitätsspitals ist die räumliche Nähe der verschiedenen Fachdisziplinen gegeben, so dass diese miteinander agieren können. Ziel ist es, ein Kompetenzzentrum für die optimale Versorgung von Frauen mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung zu etablieren. Renommierte Fachvertreterinnen und -vertreter erweitern ihre vorhandene disziplinäre Kompetenz durch die Genderaspekte zum Wohl der Patientinnen und Patienten.
Eine möglichst präzise Diagnostik soll im Zentrum stehen. Wie kann die Forschung vorangetrieben werden?
Der Ausbau der Präzisionsmedizin am Standort Zürich ist mein erklärtes Ziel. Zurzeit entsteht eine Biomedizin-Informatik-Plattform, die eine zeitgemässe Datensicherung, Datenmanagement sowie Datenaustausch zwischen Forschenden ermöglichen soll. Nur so wird es denkbar sein, mehrere hundert bis hin zu Millionen Parameter gleichzeitig abzurufen und zu analysieren. Dabei spielt das Geschlecht ebenso eine wichtige Rolle wie die Blutgruppe, das Gewicht und andere Gesundheitsdaten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Bisher laufen Forschungsprojekte, die Genderaspekte berücksichtigen unter fachspezifischen Schwerpunkten wie zum Beispiel die koronare Herzkrankheit, Autoimmunerkrankungen oder Covid-19. Klinische Studien sind bislang meist nicht auf entsprechende Differenzierungen ausgelegt. Geschlechterunterschiede in der Fallsterblichkeit nach Herzinfarkt, nach Bypass- operationen oder nach kardiovaskulären Eingriffen, die altersabhängig bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern, wurden nur in retrospektiven Analysen gefunden. Aber auch zu Geschlechterunterschieden bei Nierenerkrankungen, beim plötzlichen Herztod, bei Depressionen und Osteoporose fehlen oft systematische Studien.
Weshalb hat man sich bislang nur auf den männlichen Prototyp fokussiert?
Der Mann kennt keinen hormonellen Zyklus wie die Frau. Bei weiblichen klinischen Studienteilnehmerinnen muss dieser mitberücksichtigt werden. Dadurch wird die Forschung auf- wändiger und teurer. Die Schweiz strebt Gleichstellung und Gleichberechtigung an – auch in der biomedizinischen Forschung und in der Medizin. Deshalb ist das Bewusstsein für die geschlechtsspezifische Information gerade bei der datengetriebenen Medizin essenziell. Sonst wird in der Präzisionsmedizin der männliche Prototyp weitergeführt.
Inwiefern erhalten Sie diesbezüglich Unterstützung von der Wirtschaft?
Sowohl Forschungsinstitutionen als auch Hochschulen greifen uns unter die Arme. Im Bereich Wirtschaft wäre es sinnvoll, mit Firmen zusammenarbeiten zu können, welche Produkte im Zusammenhang mit der Frauenmedizin vertreiben. In der Schweiz existieren bereits solche Unternehmen. In einem übergeordneten Sinn wäre es im Bereich der Diversität wichtig, mehr weibliche Entrepreneure zu haben.
Welche Rolle spielen künftig genetische Analysen und künstliche Intelligenz in Bezug auf die Gendermedizin?
Die bisherige Ignoranz gegenüber den Einflüssen des biologischen Geschlechts in Diagnose, Therapie und Prävention darf nicht wie bis anhin weiterschreiten. Wir müssen erreichen, dass in der Forschung das geschlechtsspezifische Medizinwissen gefördert wird, so dass die künstliche Intelligenz nicht einen Prototypen Mensch kennt, sondern biologische weibliche und männliche Unterschiede genügend mitberücksichtigt. ★
ZUR PERSON
Beatrice Beck Schimmer, 60, studierte Humanmedizin an der Universität Bern und habilitierte im Jahr 2003 an der Universität Zürich. Von 2005 bis 2018 arbeitete sie als leitende Ärztin am Universitätsspital Zürich und ab 2009 zusätzlich als ordentliche Professorin für Anästhesiologie
im Bereich Grundlagenforschung und klinische Forschung. Von 2012 bis 2018 war sie Mitglied des nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds. Seit 2011 setzt sie sich aktiv für die weibliche Nachwuchsförderung ein. 2018 wurde Beatrice Beck Schimmer zur Direktorin Universitäre Medizin an der Universität Zürich berufen, und übt diese Funktion als erste Frau aus. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Söhne.